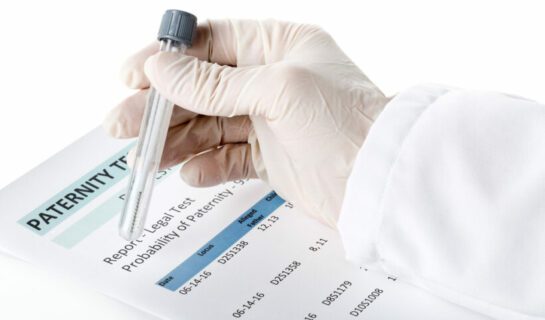Übersicht
- Das Wichtigste: Kurz & knapp
- Vorsorgevollmacht auf dem Prüfstand: Wann das Gericht trotz Vollmacht einen Betreuer bestellt
- Das Herzstück der Vorsorge: Die Geschäftsfähigkeit
- Wenn Zweifel aufkommen: die Pflicht des Gerichts zur Amtsermittlung
- Der konkrete Fall vor dem BGH: Alzheimer und eine Vollmacht auf dem Prüfstand
- Das BGH-Urteil: Zweifel reichen nicht – Positive Feststellung nötig!
- Was bedeutet „Geschäftsfähigkeit“ in der Praxis? Eine schwierige Gratwanderung
- Auch der Wille zählt: der Betreuerwunsch des Betroffenen
- Praktische Tipps: So sorgen Sie richtig vor und vermeiden Fallstricke
- FAQ: häufige Fragen zur Geschäftsfähigkeit und Vorsorgevollmacht
- Macht eine Demenzdiagnose eine Vorsorgevollmacht automatisch ungültig?
- Reicht es, wenn ein Arzt sagt, mein Vater war „wahrscheinlich nicht mehr geschäftsfähig“?
- Kann ich als Kind eine Vollmacht anfechten, die mein Elternteil einer anderen Person gegeben hat?
- Was passiert, wenn das Gericht die Vollmacht für unwirksam erklärt?
- Ist eine handschriftliche Vollmacht genauso gültig wie eine notarielle?
- Wie kann ich meine Geschäftsfähigkeit bei der Vollmachterstellung am besten „beweisen“?
- Fazit: Vorsorgevollmacht – Ein starkes Instrument, aber kein Selbstläufer

Das Wichtigste: Kurz & knapp
- Eine Vorsorgevollmacht ist nur wirksam, wenn die Person zum Zeitpunkt der Unterschrift geistig klar war und verstanden hat, was sie tut.
- Bei Zweifeln daran muss das Gericht genau prüfen, ob die Person damals noch entscheiden konnte; vage Vermutungen reichen nicht aus.
- Wenn das Gericht sicher feststellt, dass die Person nicht mehr geschäftsfähig war, kann trotz Vollmacht ein Betreuer eingesetzt werden.
- Betroffene sollten ihre Vollmacht früh erstellen, am besten mit einem ärztlichen Attest oder notarieller Beglaubigung, um spätere Zweifel zu vermeiden.
- Gerichte müssen von sich aus die Fakten prüfen und dürfen nicht einfach sagen: „Vollmacht da, keine Betreuung nötig“, wenn Unsicherheiten bestehen.
- Auch wenn eine Betreuung nötig wird, zählt der Wunsch der betroffenen Person bei der Auswahl des Betreuers.
- Für alle, die lieber selbst entscheiden möchten als durch Gericht betreut zu werden, ist eine klare und gut dokumentierte Vorsorgevollmacht besonders wichtig.
Quelle: Bundesgerichtshof (BGH) Az.: XII ZB 289/24 vom 9. Oktober 2024
Vorsorgevollmacht auf dem Prüfstand: Wann das Gericht trotz Vollmacht einen Betreuer bestellt
Stellen Sie sich vor: Ihre Mutter, nennen wir sie Frau S., hat vor einigen Jahren eine Vorsorgevollmacht erstellt. Sie hat darin ihren Sohn als Bevollmächtigten eingesetzt, für den Fall, dass sie selbst einmal nicht mehr entscheiden kann. Alle dachten, damit sei alles geregelt. Doch nun, nach einem Schlaganfall, gibt es Zweifel. Hat Frau S. die Tragweite der Vollmacht damals wirklich noch verstanden? War sie vielleicht schon geschäftsunfähig? Plötzlich steht die Frage im Raum: Gilt die Vollmacht überhaupt? Und muss trotz des Dokuments ein gerichtlicher Betreuer bestellt werden?
Dieses Szenario ist keine Seltenheit. Immer mehr Menschen sorgen mit einer Vorsorgevollmacht vor, um im Fall der Fälle die eigenen Angelegenheiten in vertraute Hände zu legen und eine gerichtliche Betreuung zu vermeiden. Doch was passiert, wenn Zweifel an der Wirksamkeit dieser Vollmacht aufkommen? Genau mit dieser heiklen Frage musste sich der Bundesgerichtshof (BGH), Deutschlands höchstes Zivilgericht, in einer aktuellen Entscheidung (Beschluss vom 9. Oktober 2024, Az. XII ZB 289/24) auseinandersetzen. Das Urteil hat weitreichende Folgen für Betroffene, Bevollmächtigte und die Gerichte selbst. Es schärft den Blick dafür, wann eine Vorsorgevollmacht wirklich trägt – und wann eben nicht.
Das Herzstück der Vorsorge: Die Geschäftsfähigkeit
Eine Vorsorgevollmacht ist ein mächtiges Instrument. Sie erlaubt es einer Person (dem Bevollmächtigten), im Namen einer anderen Person (des Vollmachtgebers) zu handeln, wenn diese dazu selbst nicht mehr in der Lage ist – sei es durch Unfall, Krankheit oder altersbedingte Einschränkungen. Der große Vorteil: Die persönlichen Wünsche des Vollmachtgebers können berücksichtigt werden, und das oft langwierige und als bürokratisch empfundene Verfahren zur Bestellung eines gerichtlichen Betreuers wird vermieden. Das Gesetz sagt klar: Eine Betreuung ist nicht erforderlich, wenn die Angelegenheiten durch einen Bevollmächtigten genauso gut besorgt werden können (§ 1814 Abs. 3 BGB).
Doch dieser Vorrang der Vollmacht hat eine entscheidende Voraussetzung: Sie muss wirksam sein. Und die wichtigste Bedingung für die Wirksamkeit ist, dass der Vollmachtgeber im Moment der Unterschrift geschäftsfähig war. Was bedeutet das?
Geschäftsfähigkeit ist die Fähigkeit einer Person, rechtlich bindende Erklärungen abzugeben, also Verträge zu schließen oder eben eine Vollmacht zu erteilen. Kinder unter sieben Jahren sind generell geschäftsunfähig. Bei Erwachsenen kann die Geschäftsfähigkeit fehlen, wenn eine krankhafte Störung der Geistestätigkeit vorliegt, die nicht nur vorübergehend ist und die freie Willensbestimmung ausschließt (§ 104 Nr. 2 BGB). Das kann bei fortgeschrittener Demenz, schweren psychischen Erkrankungen oder nach bestimmten Hirnschädigungen der Fall sein.
Wichtig ist: Nicht jede geistige Einschränkung führt automatisch zur Geschäftsunfähigkeit. Entscheidend ist, ob die Person die Bedeutung und die Tragweite ihrer Entscheidung – hier der Vollmachterteilung – noch verstehen und danach handeln konnte. Konnte sie begreifen, wem sie welche Befugnisse erteilt und welche Konsequenzen das hat?
Wenn Zweifel aufkommen: die Pflicht des Gerichts zur Amtsermittlung
Was passiert nun, wenn das Betreuungsgericht – meist auf Anregung von Ärzten, Angehörigen oder Behörden – prüft, ob für eine Person eine Betreuung eingerichtet werden muss, und dabei eine Vorsorgevollmacht vorgelegt wird? Kann das Gericht die Akte einfach schließen und sagen: „Vollmacht vorhanden, keine Betreuung nötig“?
Nein, so einfach ist es nicht. Hier kommt der sogenannte Amtsermittlungsgrundsatz ins Spiel (§ 26 FamFG). Anders als in einem typischen Zivilprozess, wo jede Partei ihre Beweise selbst beibringen muss, ist das Betreuungsgericht verpflichtet, den Sachverhalt von Amts wegen aufzuklären. Das bedeutet: Das Gericht muss selbst aktiv werden und alle notwendigen Informationen sammeln, um eine fundierte Entscheidung treffen zu können.
Und genau das gilt auch für die Frage der Wirksamkeit der Vorsorgevollmacht. Der BGH hat in seiner aktuellen Entscheidung noch einmal glasklar betont: Bestehen Anhaltspunkte dafür, dass der Vollmachtgeber bei Erteilung der Vollmacht geschäftsunfähig war, muss das Gericht diesen Zweifeln nachgehen. Es darf nicht einfach davon ausgehen, dass die Vollmacht gültig ist. „Unklarheiten, Zweifeln oder Widersprüchen hat es von Amts wegen nachzugehen“, so der Leitsatz des BGH.
Diese Pflicht zur Nachforschung ist keine bloße Formsache. Sie dient dem Schutz des Betroffenen. Denn eine Vollmacht, die im Zustand der Geschäftsunfähigkeit erteilt wurde, ist unwirksam. Sie spiegelt nicht den freien Willen des Vollmachtgebers wider und kann daher auch keine Grundlage dafür sein, auf eine notwendige Betreuung zu verzichten. Das Gericht muss also aktiv prüfen: War die Person zum Zeitpunkt X wirklich noch Herr oder Herrin ihrer Sinne?
Der konkrete Fall vor dem BGH: Alzheimer und eine Vollmacht auf dem Prüfstand
Im Fall, den der BGH zu entscheiden hatte, ging es um einen 1939 geborenen Mann, der an Alzheimer-Demenz leidet. Bereits 2019 hatte er seiner Nichte eine umfassende Generalvollmacht erteilt. Ende November 2022 stellte er zusätzlich eine schriftliche Vorsorgevollmacht für einen Herrn A. aus, der sich offenbar um ihn kümmerte. Später wurde beim Amtsgericht die Einrichtung einer Betreuung angeregt.
Das Amtsgericht und in der nächsten Instanz das Landgericht Düsseldorf bestellten tatsächlich einen berufsmäßigen Betreuer. Sie waren überzeugt, der Mann sei bei der Erteilung der Vollmacht an Herrn A. im November 2022 bereits geschäftsunfähig gewesen. Damit wäre diese Vollmacht unwirksam und könnte eine Betreuung nicht verhindern.
Woher nahmen die Gerichte diese Überzeugung? Sie stützten sich maßgeblich auf die ergänzende Stellungnahme eines Sachverständigen. Dieser Arzt hatte auf die Frage, ab wann genau der Mann geschäftsunfähig war, geantwortet, er könne dies aufgrund der ihm vorliegenden Informationen nicht exakt datieren. Allerdings sei „mit Sicherheit aktuell zu erwähnen, dass bei dem Betroffenen seit Ende des Jahres 2022, Anfang des Jahres 2023 keine Geschäftsfähigkeit vorhanden“ gewesen sei.
Das BGH-Urteil: Zweifel reichen nicht – Positive Feststellung nötig!
Hier griff der Bundesgerichtshof ein. Er hob die Entscheidung des Landgerichts auf und verwies die Sache zur erneuten Prüfung zurück. Der Grund: Die Ermittlungen zur Geschäftsfähigkeit waren unzureichend.
Der BGH machte deutlich: Die vage Aussage des Sachverständigen („seit Ende 2022, Anfang 2023“) reicht nicht aus, um mit der nötigen Sicherheit festzustellen, dass der Mann genau am 27. November 2022, dem Tag der Vollmachterteilung an Herrn A., geschäftsunfähig war. Es könnten auch erst Wochen später eingetreten sein.
Das ist der Kernpunkt: Das Gericht darf eine vorgelegte Vorsorgevollmacht nicht einfach aufgrund vager Zweifel oder allgemeiner Diagnosen ignorieren. Es muss vielmehr positiv feststellen, dass der Vollmachtgeber im konkreten Zeitpunkt der Unterschrift geschäftsunfähig war. Nur wenn diese Feststellung sicher getroffen werden kann, ist die Vollmacht unwirksam und steht einer Betreuerbestellung nicht entgegen. Bleiben nach sorgfältiger Prüfung aber Restzweifel an der Geschäftsunfähigkeit, gilt die Vollmacht im Zweifel weiter und hat Vorrang vor der Betreuung.
Der BGH knüpft damit an eine frühere Entscheidung aus dem Jahr 2022 (Az. XII ZB 544/21) an. Schon damals hatte er betont, dass Gerichte bei Zweifeln an der Geschäftsfähigkeit genau hinschauen und alle relevanten Umstände – wie ärztliche Berichte, Zeugenaussagen oder auch vorgelegte Privatgutachten – sorgfältig prüfen müssen. Die aktuelle Entscheidung bekräftigt diese Linie: Die Amtsermittlungspflicht ist ernst zu nehmen.
Wichtige Klarstellung des BGH:
- Amtsermittlung: Das Gericht muss von sich aus prüfen, ob der Vollmachtgeber bei der Unterschrift geschäftsfähig war, wenn es Zweifel gibt (§ 26 FamFG).
- Zeitpunkt: Entscheidend ist die Geschäftsfähigkeit genau im Moment der Vollmachterteilung. Eine spätere oder frühere Geschäftsunfähigkeit ist nicht ausschlaggebend.
- Beweislast: Das Gericht muss die Geschäftsunfähigkeit positiv feststellen. Bloße Zweifel oder vage ärztliche Aussagen reichen nicht aus, um eine Vollmacht für unwirksam zu erklären.
- Folge: Nur wenn die Unwirksamkeit sicher feststeht, darf das Gericht trotz Vollmacht einen Betreuer bestellen (wenn die Betreuungsvoraussetzungen sonst vorliegen).
Was bedeutet „Geschäftsfähigkeit“ in der Praxis? Eine schwierige Gratwanderung
Die Entscheidung des BGH unterstreicht die zentrale Bedeutung der Geschäftsfähigkeit, wirft aber auch ein Schlaglicht auf die praktischen Schwierigkeiten. Wie lässt sich im Nachhinein, oft Jahre später, feststellen, ob jemand an einem bestimmten Tag noch in der Lage war, die Tragweite einer Vorsorgevollmacht zu erfassen?
Gerade bei schleichenden Erkrankungen wie Demenz ist dies oft eine Gratwanderung. Die geistigen Fähigkeiten lassen nach, aber nicht unbedingt linear. Es kann „lichte Momente“ geben, in denen eine Person durchaus noch klar denken und entscheiden kann, auch wenn sie sonst oft verwirrt ist.
Zur Klärung dieser Frage wird das Gericht in der Regel auf Sachverständigengutachten zurückgreifen. Ein psychiatrischer oder neurologischer Gutachter wird versuchen, anhand von Krankenakten, Arztbriefen, Zeugenaussagen (von Ärzten, Pflegepersonal, Angehörigen, dem Notar etc.) und eventuell einer Untersuchung des Betroffenen (falls noch möglich und sinnvoll) ein Bild von dessen geistigem Zustand zum relevanten Zeitpunkt zu zeichnen.
Doch auch Gutachter können oft keine hundertprozentig sichere Aussage treffen, insbesondere wenn der Zeitpunkt der Vollmachterteilung weit zurückliegt und wenig dokumentiert ist. Hier muss das Gericht dann alle Indizien sorgfältig abwägen.
Indizien, die für Geschäftsfähigkeit sprechen können:
- Die Person hat sich aktiv mit der Vollmacht beschäftigt, Fragen gestellt.
- Der Inhalt der Vollmacht ist nachvollziehbar und entspricht früheren Äußerungen.
- Es gibt Zeugen (z. B. Notar, Bankberater, Freunde), die den Eindruck hatten, die Person sei klar und orientiert gewesen.
- Zeitnahe ärztliche Atteste bestätigen die Geschäftsfähigkeit.
Indizien, die gegen Geschäftsfähigkeit sprechen können:
- Eine fortgeschrittene Demenzdiagnose zum relevanten Zeitpunkt.
- Aussagen von Ärzten oder Pflegepersonal über erhebliche Verwirrtheit oder Desorientierung.
- Der Inhalt der Vollmacht erscheint widersprüchlich oder unplausibel.
- Zeugen berichten von irrationalem Verhalten oder fehlendem Verständnis.
- Der Bevollmächtigte wurde unter fragwürdigen Umständen eingesetzt (z. B. Druckausübung).
Das Gericht muss all diese Mosaiksteine zu einem Gesamtbild zusammenfügen und entscheiden, ob die positive Feststellung der Geschäftsunfähigkeit gelingt. Gelingt dies nicht, bleibt die Vollmacht wirksam.
Auch der Wille zählt: der Betreuerwunsch des Betroffenen
Der BGH nutzte die Gelegenheit, noch auf einen weiteren wichtigen Punkt hinzuweisen: Selbst wenn eine Betreuung erforderlich sein sollte (weil entweder keine wirksame Vollmacht vorliegt oder diese nicht alle Bereiche abdeckt), muss das Gericht bei der Auswahl des Betreuers die Wünsche des Betroffenen berücksichtigen (§ 1816 Abs. 2 BGB).
Im konkreten Fall hatte der Mann nicht nur die Vollmacht für Herrn A. ausgestellt, sondern auch in einem späteren Dokument (einer Generalvollmacht vom Mai 2023, deren Wirksamkeit ebenfalls fraglich war) verfügt, dass Herr A. sein Betreuer werden solle. Zudem hatte er diesen Wunsch im Verfahren mehrfach geäußert.
Der BGH stellte klar: Ein solcher Betreuerwunsch ist auch dann beachtlich, wenn der Betroffene nicht mehr voll geschäftsfähig ist. Es reicht aus, wenn er seinen Willen oder Wunsch äußern kann. Das Gericht muss diesem Wunsch folgen, es sei denn, die gewünschte Person ist ungeeignet oder die Bestellung würde dem Wohl des Betroffenen zuwiderlaufen.
Dies zeigt: Selbst wenn die Fähigkeit zu komplexen rechtlichen Entscheidungen (Geschäftsfähigkeit) fehlt, soll der natürliche Wille des Menschen so weit wie möglich respektiert werden.
Praktische Tipps: So sorgen Sie richtig vor und vermeiden Fallstricke
Die Entscheidung des BGH hat klare Botschaften für alle, die eine Vorsorgevollmacht errichten oder als Bevollmächtigte eingesetzt werden sollen:
Für Vollmachtgeber:
- Rechtzeitig handeln: Errichten Sie Ihre Vorsorgevollmacht, solange Sie zweifelsfrei geschäftsfähig sind. Warten Sie nicht, bis erste Anzeichen einer Erkrankung auftreten, die Zweifel säen könnten.
- Klare Formulierungen: Beschreiben Sie genau, welche Befugnisse Sie erteilen wollen. Standardformulare können helfen, sollten aber auf Ihre persönliche Situation angepasst werden.
- Notarielle Beurkundung erwägen: Eine notarielle Beurkundung ist zwar keine Garantie für die Wirksamkeit (auch ein Notar kann sich irren oder die Geschäftsfähigkeit nicht abschließend prüfen), sie erhöht aber die Akzeptanz der Vollmacht im Rechtsverkehr (z. B. bei Banken, Grundbuchämtern) und der Notar ist verpflichtet, die Geschäftsfähigkeit zu prüfen und dies zu dokumentieren. Das kann spätere Zweifel erschweren.
- Ärztliches Attest (optional, aber sinnvoll): Wenn Sie bereits an einer Krankheit leiden, die potenziell die Geschäftsfähigkeit beeinträchtigen könnte (z. B. beginnende Demenz, Parkinson, psychische Erkrankung), oder wenn Sie befürchten, dass Ihre Geschäftsfähigkeit später angezweifelt werden könnte (z. B. wegen Familienstreitigkeiten), holen Sie zeitgleich zur Unterzeichnung der Vollmacht ein ärztliches Attest ein, das Ihre aktuelle Geschäftsfähigkeit bestätigt. Bewahren Sie dieses Attest sorgfältig zusammen mit der Vollmacht auf.
- Regelmäßige Überprüfung: Überprüfen Sie Ihre Vollmacht alle paar Jahre und passen Sie sie gegebenenfalls an veränderte Lebensumstände oder Wünsche an. Eine Bestätigung bei voller Geschäftsfähigkeit kann ebenfalls sinnvoll sein.
- Hinterlegung: Registrieren Sie Ihre Vorsorgevollmacht im Zentralen Vorsorgeregister (ZVR) der Bundesnotarkammer. So können Betreuungsgerichte im Bedarfsfall schnell prüfen, ob eine Vollmacht existiert.
Für Bevollmächtigte:
- Voraussetzungen prüfen: Wenn Sie gebeten werden, als Bevollmächtigter zu fungieren, überzeugen Sie sich (soweit möglich) davon, dass der Vollmachtgeber die Bedeutung der Vollmacht versteht. Sprechen Sie offen darüber.
- Dokumentation aufbewahren: Bewahren Sie die Originalvollmacht sicher auf. Falls vorhanden, auch das ärztliche Attest zur Geschäftsfähigkeit.
- Bereit zur Auskunft: Seien Sie darauf vorbereitet, dass Gerichte oder Behörden im Zweifel Fragen zur Entstehung der Vollmacht und zur Geschäftsfähigkeit des Vollmachtgebers stellen könnten. Informationen über den Zustand des Vollmachtgebers zum Zeitpunkt der Unterschrift können wichtig sein.
- Im Sinne des Vollmachtgebers handeln: Nutzen Sie die Vollmacht ausschließlich im besten Interesse und nach den (mutmaßlichen) Wünschen des Vollmachtgebers.
FAQ: häufige Fragen zur Geschäftsfähigkeit und Vorsorgevollmacht
Macht eine Demenzdiagnose eine Vorsorgevollmacht automatisch ungültig?
Nein. Entscheidend ist nicht die Diagnose an sich, sondern ob die Person im Moment der Unterschrift die Tragweite der Vollmacht noch verstehen konnte. Gerade im Frühstadium einer Demenz ist dies oft noch der Fall.
Reicht es, wenn ein Arzt sagt, mein Vater war „wahrscheinlich nicht mehr geschäftsfähig“?
Laut BGH reicht eine solche vage Aussage oder eine reine Wahrscheinlichkeit nicht aus. Das Gericht muss die Geschäftsunfähigkeit positiv feststellen, also mit ausreichender Sicherheit davon überzeugt sein.
Kann ich als Kind eine Vollmacht anfechten, die mein Elternteil einer anderen Person gegeben hat?
Sie können beim Betreuungsgericht die Einrichtung einer Betreuung anregen und Ihre Zweifel an der Wirksamkeit der Vollmacht (wegen Geschäftsunfähigkeit) darlegen. Das Gericht muss diesen Zweifeln dann von Amts wegen nachgehen.
Was passiert, wenn das Gericht die Vollmacht für unwirksam erklärt?
Wenn die Voraussetzungen für eine Betreuung vorliegen (also Hilfebedarf besteht), wird das Gericht einen Betreuer bestellen. Dabei wird es aber prüfen, ob der Betroffene Wünsche zur Person des Betreuers geäußert hat.
Ist eine handschriftliche Vollmacht genauso gültig wie eine notarielle?
Grundsätzlich ja (außer für bestimmte Geschäfte wie Immobiliengeschäfte, hier ist oft notarielle Form nötig). Die notarielle Beurkundung hat aber den Vorteil der besseren Akzeptanz und der dokumentierten Prüfung der Geschäftsfähigkeit durch den Notar, was spätere Zweifel erschweren kann.
Wie kann ich meine Geschäftsfähigkeit bei der Vollmachterstellung am besten „beweisen“?
Eine notarielle Beurkundung und/oder ein zeitgleich erstelltes ärztliches Attest sind die besten Mittel, um die Geschäftsfähigkeit zu dokumentieren und späteren Anfechtungen vorzubeugen.
Fazit: Vorsorgevollmacht – Ein starkes Instrument, aber kein Selbstläufer
Die Entscheidung des Bundesgerichtshofs ist ein wichtiges Signal: Die Vorsorgevollmacht bleibt das zentrale Instrument der Selbstbestimmung für den Fall nachlassender geistiger Kräfte. Ihr Vorrang vor der gerichtlichen Betreuung ist gesetzlich verankert und wird von den Gerichten respektiert.
Gleichzeitig macht das Urteil aber unmissverständlich klar: Dieser Vorrang gilt nur für wirksame Vollmachten. Wo begründete Zweifel an der Geschäftsfähigkeit des Vollmachtgebers im Moment der Unterschrift bestehen, sind die Gerichte in der Pflicht, genau hinzusehen und diese Zweifel aktiv aufzuklären. Sie dürfen sich nicht mit vagen Vermutungen zufriedengeben, sondern müssen die Geschäftsunfähigkeit positiv feststellen, bevor sie eine Vollmacht übergehen.
Für Bürgerinnen und Bürger bedeutet das: Eine sorgfältig und rechtzeitig erstellte Vorsorgevollmacht, idealerweise mit Nachweisen über die Geschäftsfähigkeit zum Zeitpunkt der Errichtung, ist der beste Weg, um die eigenen Angelegenheiten auch in schwierigen Zeiten selbstbestimmt zu regeln. Sie ist ein starkes Fundament – aber eben eines, dessen Stabilität im Zweifel auch einer gerichtlichen Prüfung standhalten muss. Wer hier vorausschauend plant, schafft die besten Voraussetzungen dafür, dass sein Wille auch dann respektiert wird, wenn er ihn selbst nicht mehr äußern kann.